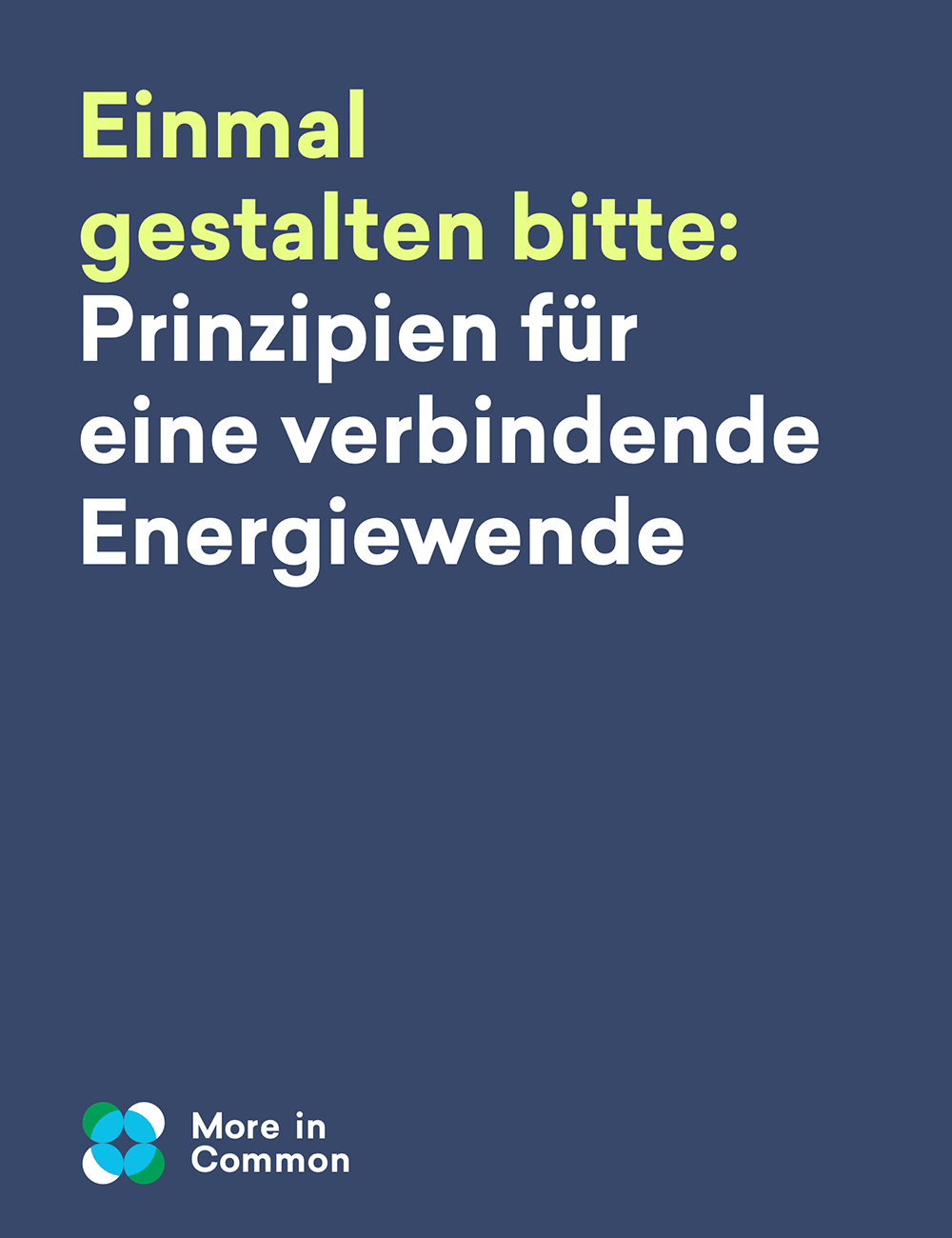
- Klima & Umwelt
- Mai 2024
Einmal gestalten bitte: Prinzipien für eine verbindende Energiewende
Über Fragen der Energiewende wurde zuletzt heiß gestritten. In diesem Impulspapier gehen wir anhand qualitativer Forschung der Frage nach, wie die Energiewende aus Bevölkerungssicht verbindend gelingen kann.
Einer der derzeit meistdiskutierten Bereiche der Klimapolitik ist wohl die Energiewende – also die Frage, woher Strom und Wärme und auch Mobilität kommen, wie wir sie organisieren und bezahlen. Schnell geht es in diesen Fragen heiß her, wie uns die Lage rund um das „Heizungsgesetz“ aus dem Jahr 2023 belegt. Die Grenzen zwischen dem Ruf nach kollektiven Regeln und der Angst vor Überforderung sind unscharf und schnell überschritten. Um hierbei gute Entscheidungen auszuhandeln, braucht es Streit – aber es braucht auch ein Mindestmaß an Konstruktivität und Gestaltungswillen von allen Seiten. Sonst gerät das eigentlich Verbindende, nämlich die breit geteilte Sorge vor dem Klimawandel, womöglich aus dem Fokus; und unnötig scharfe Polarisierung kann sich Bahn brechen.
Genau in diesem Kontext – und im Rahmen unserer generellen Arbeit zur Klimadebatte – wollten wir von More in Common mehr darüber erfahren, was Menschen aus verschiedenen Teilen unserer Gesellschaft derzeit eigentlich über die Energiewende denken. Neben der Frage, wie sie die dazugehörige Debatte derzeit wahrnehmen, interessierte uns vor allem ihr konstruktiver Zukunftsausblick: Was wünschen sich Menschen für eine gelingende Energiepolitik, die Raum für Zuspruch und vielleicht sogar Identifikation bietet? Wie sieht also eine Energiewende aus, die verbindet? Mit Antworten auf diese Fragen wollen wir Akteuren der Klimadebatte mit unserem Impulspapier dabei helfen, programmatische Vorschläge mit gesellschaftlichem Zukunftspotenzial zu formulieren.
Forschung mit sechs Fokusgruppen in Ostdeutschland
Zu diesem Zweck haben wir uns – in bewährter Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Verian (früher Kantar Public) – im Februar 2024 im Rahmen qualitativer Forschung ausführlich mit Menschen über ihre Ansichten, ihre relevanten Grundsätze (z.B. von Gerechtigkeit) und ihre Gestaltungspräferenzen zur Energiewende unterhalten. Um dabei eine möglichst breite gesellschaftliche Perspektivenvielfalt zu wahren, haben wir das in Form von sechs Fokusgruppen entlang der More in Common-Typologie getan, die anhand von Werten, Normen und Grundüberzeugen sechs gesellschaftliche Typen in der deutschen Bevölkerung identifiziert.
Außerdem haben wir uns dafür entschieden, bewusst auf den Osten unserer Republik zu fokussieren (und zwar unter möglichst gleichmäßiger Berücksichtigung all seiner Regionen). Wir wollten damit gezielt den Menschen in Regionen zuhören, in denen erstens bereits in den letzten Jahrzehnten komplexe Transformationserfahrungen gemacht wurden, zweitens bestimmte gesamtdeutsche Problembefunde (etwa Zurücksetzungsgefühle oder Institutionenmisstrauen) verdichtet auftreten, und in denen drittens bestimmte Herausforderungen der Energiewende (etwa beim Windkraftausbau) besonders greifbar sind. Zugleich sind wir zuversichtlich, dass unsere Ableitungen daraus auch für die gesamtdeutsche Debatte relevant sind.
„Für alle bezahlbar und transparenter machen, was für Vor- und Nachteile man hat. Man investiert ja immer wieder, weil man immer wieder steuerliche Vorteile hat, wenn man sich was kauft und die Anlage erweitert. Es ist ja irgendwo Geldanlage und (man) will mit dem Geld arbeiten, was man verdient hat.“
– Aus der Fokusgruppe der Enttäuschten
Autor
Jérémie Gagné
Projektmitarbeit
Gesine Höltmann
Anna Lob
Presse
Anfragen an presse@moreincommon.com
Briefings und Vorträge
Anfragen an deutschland@moreincommon.com
