Forschung
Was verbindet die Menschen in Deutschland, was trennt sie? Wie entwickeln sich Vertrauen, Konfliktfähigkeit und andere wichtige Kenngrößen in unserer Gesellschaft? Auf diese Fragen suchen wir mithilfe von sozialpsycholigischer Forschung nach Antworten.
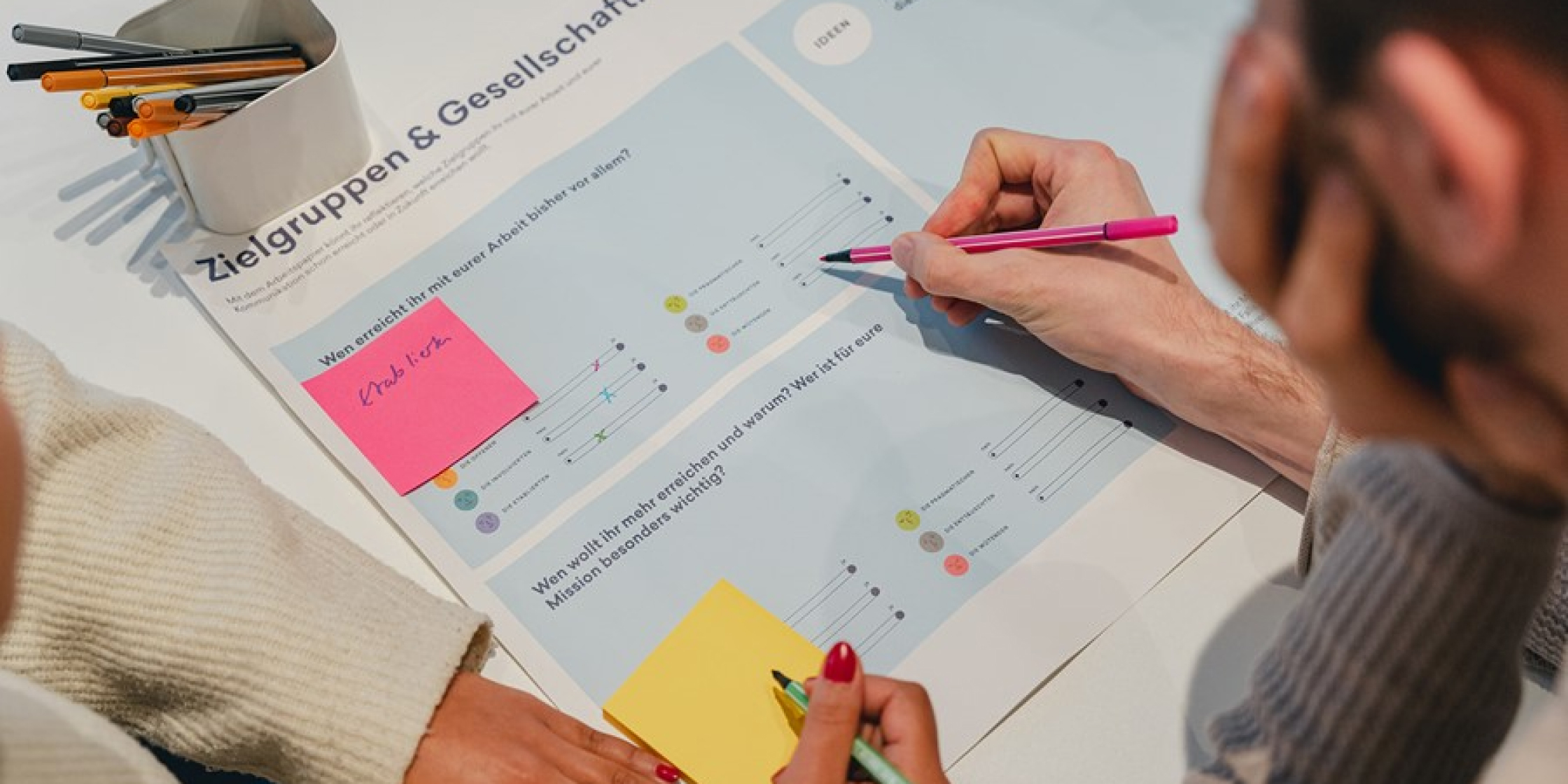
Sozialpsychologischer Forschungsansatz
Wir nutzen einen neuartigen Forschungsansatz, der sozialpsychologische Erkenntnisse mit Instrumenten der Meinungsforschung verbindet. So können wir „von der Wurzel her“ nachvollziehen, wo, wie und warum es zwischen bestimmten Gruppen von Menschen in manchen Fragen zu Spannungen kommt – aber auch, wo es Potenziale für Gemeinsamkeit gibt. Zusammenhalt fördern heißt auch, mit Unterschieden in der Gesellschaft umzugehen. Deswegen machen wir über statistische Verfahren sichtbar, wie sich bestimmte gesellschaftliche Perspektiven über die Bevölkerung verteilen. Mit der sogenannten Segmentationsforschung (Link 6 gesellschaftliche Typen) identifizieren wir Gruppen von Menschen mit jeweils ähnlichen Werten und Grundüberzeugungen, die sich von anderen in ihrer Sichtweise auf die gesellschaftliche Realität unterscheiden.
Mit unserem sozialpsychologischen Ansatz gehen wir über gängige Meinungsforschung hinaus, die in der Regel politisch-gesellschaftliche Einstellungen der Menschen entlang von parteipolitischen und soziodemografischen Variablen (z. B. Alter, Bildung, Geschlecht) auswertet und auf dieser Ebene nach Verbindungs- und Trennlinien sucht. So wagen wir bewusst einen frischen analytischen Blick auf Gesellschaft, der andere Ansätze nicht ersetzt, sondern ergänzen soll. In der Regel verbinden wir in unseren Studien quantitative mit qualitativen Methoden. In quantitativen Erhebungen gewinnen wir belastbare Daten zu Einstellungen und Normen in der Bevölkerung, während uns qualitative Forschungsgespräche die Möglichkeit zur Exploration, Einordnung und Nuancierung von Befunden geben. Für unsere Erhebungen in Deutschland arbeiten wir mit anerkannten Meinungsforschungsinstituten Verian und YouGov zusammen.
Länderübergreifendes Forschen und Lernen
Wir forschen nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen More in Common-Ländern Frankreich, Großbritannien, Polen, Spanien, USA und Brasilien. Gemeinsam entwickeln wir unsere Methoden weiter und lernen bei Forschungsinstrumenten sowie -inhalten regelmäßig voneinander. Außerdem führen wir manche Forschungsprojekte länderübergreifend durch, was uns direkte Vergleiche zwischen den gesellschaftlichen Dynamiken in den einzelnen Ländern ermöglicht.
Zusammenarbeit mit Universitäten
Wir arbeiten von Anfang an mit Experten und Expertinnen u.a. aus der Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie zusammen. Diese Partnerschaften erlauben es uns, unsere Erkenntnisse besser an den akademischen Forschungsstand anzuknüpfen und darauf aufzubauen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben wir beispielsweise Methoden wie den Implicit Association Test (entwickelt an der Harvard University) und die Moral Foundations Theory (entwickelt von Dr. Jonathan Haidt) in unser Instrumentarium aufgenommen. Der regelmäßige Austausch mit Forschern und Forscherinnen hilft uns, uns mit neuen Forschungsmethoden und Erkenntnissen auseinanderzusetzen.
